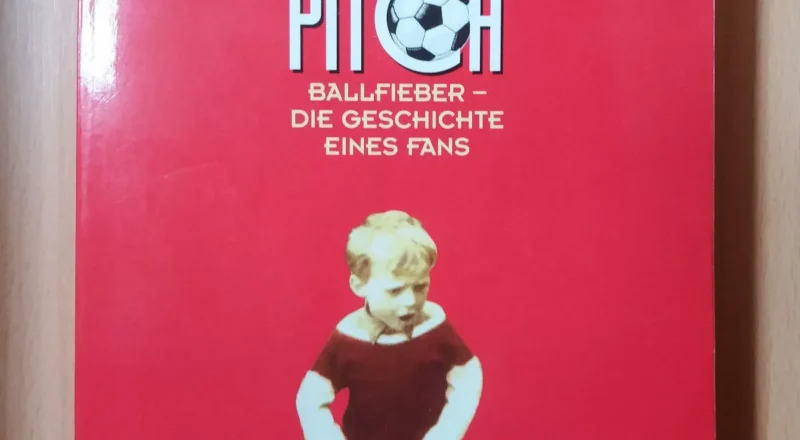Der englische Autor Nick Hornby wurde vor allem bekannt mit Romanen wie About a Boy oder A Long Way Down. Sein erstes Werk aus dem Jahr 1992 heißt aber Fever Pitch, auf Deutsch: Ballfieber. Selbst wer mit Hornby und diesem Buch nicht vertraut ist, kann sich aufgrund des Titels vermutlich denken, wovon das Buch handelt. Es geht natürlich um das, was sowohl für Engländer als auch für Deutsche die schönste Nebensache der Welt ist: Fußball. Damit ist es nach The Great Nowitzki von Thomas Pletzinger das zweite Buch in diesem Blog, das etwas mit Sport zu tun hat.
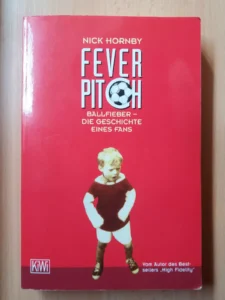
Genauer gesagt hat Fever Pitch autobiographische Züge. Hornby beschreibt hier sein Leben als Fußballfan und seine Liebe zu seinem Lieblingsclub FC Arsenal. Das Buch ist der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt als andere Werke des Autors. Unter Fußballfans auf der ganzen Welt handelt es sich aber seit Jahrzehnten um ein Kultbuch.
Bereits der allererste Satz des Buchs legt nahe, welche Beziehung der Autor zum Fußball hat, eine Beziehung, die er mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt teilt.
Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden
Fever Pitch beschreibt den Alltag eines „fanatischen“ Fußball-Fans
Ich selbst bin als Fußballfan groß geworden und hatte früher eine ähnlich enge Beziehung zu meinem Verein wie Nick Hornby zu Arsenal. Daher konnte ich mich sehr gut mit dieser Erzählung identifizieren. Ich denke aber, dass das Buch auch für Nicht-Fußballfans oder Gelegenheitsfans (im Englischen gerne als Casuals und im Deutschen als Normalos bezeichnet) spannend zu lesen ist. Es verdeutlicht gut, wie das Leben als Fan aussieht. Das Wort Fan ist ursprünglich kurz für Fanatic, also Fanatiker. Ein gewisses Maß an Fanatismus und zuweilen irrationaler Hingabe werden die meisten Fußballfans sich selbst nicht absprechen können.
Hornby beschreibt in Fever Pitch, was das Fansein ausmacht, das für Außenstehende tatsächlich meistens sehr irrational wirkt. Der Terminplan wird strikt mit dem Spielplan abgeglichen – wobei der Spielplan selbstverständlich Vorrang hat. Persönliche Beziehungen müssen hinten anstehen, wenn der Verein spielt. Die Liebe zum Verein kann größer sein als die Liebe zur Freundin. Urlaub wird für Auswärtsfahrten anstatt für Erholung am Meer genutzt. Das Ergebnis am Wochenende bestimmt die Laune der darauffolgenden Woche(n). Eine Niederlage kann tiefe Depressionen verursachen, ein Sieg extreme Glücksgefühle. Was für „normale“ Menschen schräg und verschroben wirkt, ist für Hornby und Millionen anderer Fußballfans auf der ganzen Welt normaler Alltag.
Wer als Außenstehender das Buch gelesen hat, wird sich nicht mehr großartig wundern, dass beispielsweise Schalke 04 oder der Hamburger SV nach Jahren des Misserfolgs in der 2. Bundesliga einen Zuschauerschnitt von über 60.000 bzw. über 50.000 pro Spiel haben. Fußball wird gerne als Religion bezeichnet, und für viele ist es auch genau das.
Nick Hornby lässt auch eher kontroverse und kritische Themen des Fußballs wie den Hooliganismus und die immer weiter zunehmende Kommerzialisierung nicht aus. Ersteres war im Zeitraum der Handlung des Buchs, vor allem in den 80ern, noch ein weitaus größeres Problem als heute (siehe beispielsweise Heysel-Katastrophe). Letzteres steckte damals noch in den Kindesbeinen und nahm erst nach dem Jahrtausendwechsel richtig Fahrt auf. Für Fußballfans ist das Buch daher auch aus historischen Gründen spannend. Was der Autor erlebt hat, ist teilweise doch ein anderes Erlebnis als das heutiger Fußballfans. Zudem erfährt man mehr über die Geschichte des englischen Fußballs und die des FC Arsenal im Speziellen.
Nick Hornby mit der für ihn eigenen Selbstironie
Das alles wird aber nicht in einem verbissenen Tonfall beschrieben, sondern mit viel Selbstironie. Auch falls man nach der Lektüre der Meinung ist, dass es sich bei Hornby und anderen Fußballfans um Verrückte handelt, ist der Schreibstil doch sehr sympathisch. Hornby ist sich vollkommen bewusst, dass er „verrückt“ ist. Gerade das macht den Stil des Buchs so besonders. Die selbstironische Ader des Autors kennt man aus anderen Büchern. Hier kommt sie besonders zum Vorschein. Das folgende Zitat beschreibt das Verhältnis zum Fußball ganz gut:
Sich zu amüsieren, indem man leidet, war für mich ein vollkommen neuer Gedanke
Man erfährt auch mehr über das Leben des Autors abseits des Fußball. Wobei am Ende dann doch immer wieder die Brücke zum Sport geschlagen wird. Der Fußball war für Hornby auch die Stütze in der Beziehung zu seinem Vater, nachdem seine Eltern sich hatten scheiden lassen. Er beschreibt auch, wie er sich einmal für eine Weile vom Fußball abwenden wollte um sich auf das Leben abseits davon zu konzentrieren. Ein Unterfangen, das sich als hoffnungslos herausstellte.
Es hat nach dem Erscheinen von Fever Pitch andere autobiographische Bücher von Fußballfans gegeben, von denen ich zwei oder drei gelesen habe. Keines davon kam auch nur annähernd an das Original heran. Dort ist ja auch alles gesagt, was das Leben eines „Bekloppten“ ausmacht. Für Fußballfans, also Fanatiker, ist Fever Pitch sowieso ein Muss. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Buch auch andere Menschen begeistern kann. Selbst wenn es nur als Sozialstudie dient.
Fever Pitch wurde nebenbei bemerkt auch gleich zweimal verfilmt. Allerdings habe ich keinen der Filme gesehen und kann daher keine Bewertung dazu abgeben. Der zweite Film aus dem Jahr 2005 ist aber ein Remake aus den USA und hat mit der Originalhandlung anscheinend nicht mehr allzu viel zu tun (es geht wohl um Baseball). Am ersten Film aus dem Jahr 1997 wirkte Hornby selbst mit und schrieb das Drehbuch.